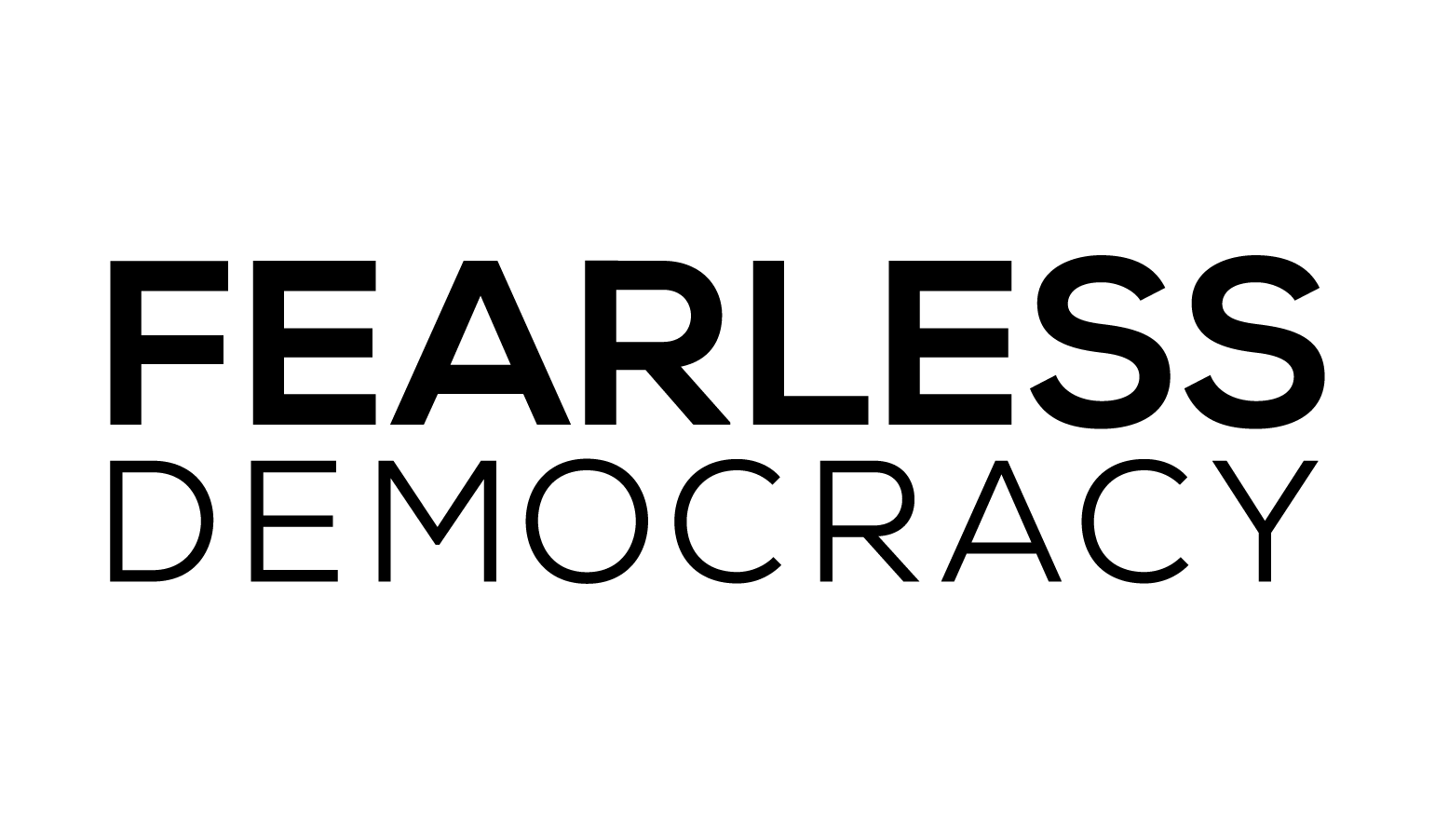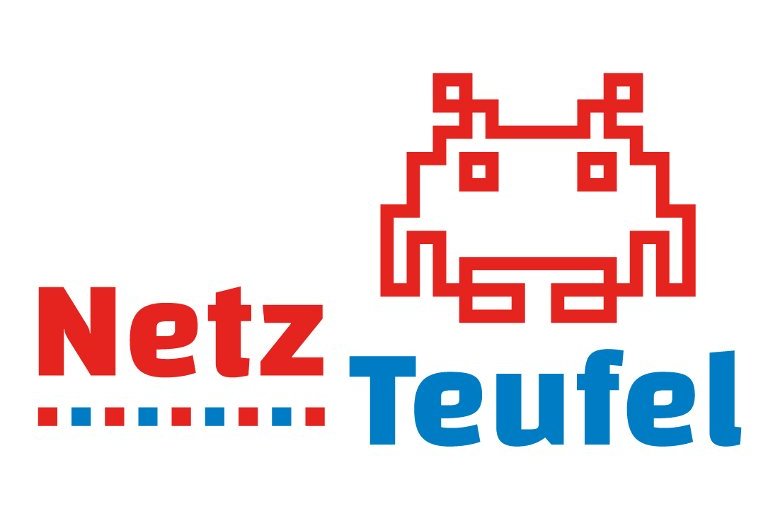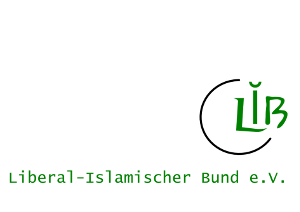Folge Campact
5-Minuten-Info
Hate Speech (deutsch: Hass-Sprache) ist ein Oberbegriff für das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit im Internet. Täter*innen beleidigen andere Menschen, werten sie ab oder greifen sie an. Zum Teil rufen sie zu Hass oder Gewalt auf. Hate Speech ist keine einfache Meinungsäußerung. 1997 hat ein Ministerkomitee des Europarats klar definiert, was unter Hate Speech (Hassrede) zu verstehen ist: “Der Begriff ‘Hassrede’ (umfasst) jegliche Ausdrucksformen, welche Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von Hass, die auf Intoleranz gründen, propagieren, dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen, einschließlich der Intoleranz, die sich in Form eines aggressiven Nationalismus und Ethnozentrismus, einer Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, Einwanderern und der Einwanderung entstammenden Personen ausdrücken.” Hasskommentare können strafbar oder nicht strafbar sein. Es gibt allerdings bisher keine einheitliche juristische Definition von Hate Speech.
Hate Speech ist eine Form von psychischer Gewalt, die bei den Betroffenen zu Erkrankungen wie Depressionen oder Schlafstörungen führen kann. In Extremfällen begehen Menschen sogar Suizid. Eine von uns in Auftrag gegebene, repräsentative Studie zeigt: Unter den Folgen von Hate Speech leiden besonders junge Menschen. 31 Prozent der 18- bis 24-Jährigen klagen über Depressionen als Folge von Hass und Belästigungen im Netz. Neben den direkten körperlichen und emotionalen Folgen hat der erlebte Hass aber auch Konsequenzen auf das Verhalten der Betroffenen. Häufig trauen sie sich nicht mehr so offen, ihre politische Meinung im Internet zu äußern. Dieser Effekt von Hate Speech zeigt aber auch bei vielen anderen User*innen Wirkung. In unserer repräsentativen Studie zu Hate Speech gaben 54 Prozent der Befragten an, aus Angst vor Hass und Belästigungen seltener ihre politische Meinung im Netz zu äußern. Das zeigt: Hate Speech schränkt die freie Meinungsäußerung ein und bedroht damit unsere Demokratie.
Leider ja. Hate Speech ist im Netz allgegenwärtig. Das belegen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Forsa aus dem Jahr 2018. Die Umfrage ergab: Drei Viertel der Befragten war schon einmal Hate Speech im Netz ausgesetzt. Besonders auffällig: Unter jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren waren es sogar 96 Prozent.
In Netzwerken wie „Reconquista Germanica“ oder “#Infokrieg” sammeln sich tausende rechte Aktivist*innen. Gemeinsam verbreiten sie Hass in Foren von öffentlich-rechtlichen Sendern, bei Facebook oder in den Kommentarspalten von Online-Medien wie Spiegel oder Focus. Sie beleidigen, bedrohen oder erniedrigen ihr Gegenüber – und machen es mundtot. Die Gruppen arbeiten organisiert: Jedes Mitglied hat mehrere Identitäten im Netz. So können sie zeitgleich mehrere Hasskommentare versenden. Dabei geht es ihnen auch um die Außenwirkung: Wer die Diskussion verfolgt, soll den Eindruck bekommen, die Rechten wären mit ihrer Meinung in der Mehrheit. Die Debatten im Netz färben sie so gezielt braun ein. Mit Erfolg: Vieles, was vor Jahren noch als rechts tabuisiert war, kann jetzt öffentlich geäußert werden.
Das hat mehrere Gründe: Zu wenig Anzeigen Laut einer Umfrage von Bitkom zeigen nur 19 Prozent der Opfer die Täter*innen auch an. Mangelnde Kapazitäten und Ausbildung bei der Polizei Betroffene beklagen, dass sie nicht ernst genommen werden oder die Polizei keine Kapazitäten hat. Ermittlungen dauern zu lange Betroffene warten bis zu einem Jahr auf Ermittlungsergebnisse. Staatsanwaltschaften erkennen orchestrierten Hass nicht Fälle werden einzeln behandelt. So wird nicht klar, wann es sich um gezielte Angriffe handelt. Prozesse sind zu teuer Erfolg gegen Hate Speech haben in den meisten Fällen nur Zivilklagen. Da müssen die Kläger*innen aber in Vorkasse gehen. Das kann sich nicht jede*r leisten.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtete die Betreiber*innen von Plattformen – wie Facebook oder X (ehemals Twitter) – dazu, strafrechtlich relevante Hate Speech zu löschen. Seit April 2021 müssen die Betreiber*innen diese Inhalte nun auch an das BKA melden. Diese Neuerung ist grundsätzlich zu begrüßen, denn Löschen alleine reicht nicht: Hass im Netz muss auch verfolgt werden. Fraglich ist allerdings, ob das BKA an dieser Stelle der richtige Adressat ist. Es besteht die Gefahr, dass das BKA so auch Daten von Nutzer*innen speichern kann, wenn sich ein Anfangsverdacht nicht bestätigt. Sinnvoller wäre es, Hasspostings direkt zur Prüfung an die Staatsanwaltschaften zu leiten. Sie könnten dann entscheiden, ob sich ein Anfangsverdacht bestätigt und Ermittlungen gegen den*die Täter*in verfolgt werden. Es wird zu beobachten sein, welche Auswirkungen diese Neuerung in der Praxis haben wird.
Strafverfolgung, Opferberatung, Gewaltprävention – das ist Ländersache. Also wenden wir uns mit der Kampagne an die Justizministerkonferenz. Hier sitzen die Justizminister*innen aller Bundesländer an einem Tisch und vereinbaren, in welchen Bereichen rechtspolitisch Handlungsbedarf besteht und setzen gemeinsame Entwicklungsziele für die deutsche Justiz.
- „Was ist Hate Speech?”, Amadeu Antonio Stiftung
- „Junge Frauen als gute Opfer. Wie Rechte ihre Propaganda nach Handbuch verbreiten„, Berliner Zeitung, 26. Februar 2018
- „Geh sterben! Umgang mit Hate Speech und Kommentaren im Internet„, Amadeo Antonio Stiftung
- „Öfter im Shitstorm„, Fluter, 7. Dezember 2016
- „Forsa Umfrage zu Hate Speech„, Landesanstalt für Medien NRW, 21. März 2022
- “Hass auf Knopfdruck„, ISD/Ichbinhier, 5. Juli 2018
- “Hassrede und Radikalisierung im Netz„, ISD, 26. September 2018
- „#Hass im Netz„, IDZ/Campact, 3. Juli 2019
- Hassrede und Radikalisierung im Netz: Dieser Forschungsbericht gibt interdisziplinäre Einblicke in die aktuellen Entwicklungen extremistischer Aktivitäten im Netz.
Fall Walter Lübcke – Hasspropaganda im Internet
Aktuelles zum Thema Hate Speech
Viele Täter*innen gehen straffrei aus
Bislang können Täter*innen Hate Speech im Internet relativ ungestört verbreiten. Oft erstatten Betroffene keine Anzeige – auch, weil Betroffene, die zur Polizei gehen, beklagen, dass sie nicht ernst genommen werden oder die Polizei keine Kapazitäten hat. Kommt es zu einer Ermittlung, dauern diese oft sehr lange. Betroffene warten bis zu einem Jahr auf Ermittlungsergebnisse. Die Fälle werden einzeln behandelt – orchestrierter Hass bleibt so unerkannt. Erfolg gegen Hate Speech haben in den meisten Fällen nur Zivilklagen. Dafür müssen die Kläger*innen aber in Vorkasse gehen. Das kann sich nicht jede*r leisten.
Das Netz-DG reicht nicht aus
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtet die Betreiber*innen von Plattformen – wie Facebook oder Twitter – strafrechtlich relevante Hate Speech zu löschen. Das ist umstritten, denn so bestimmen die Betreiber*innen, was geäußert werden darf und was nicht. Nur wenn strafbare Kommentare konsequent angezeigt und verfolgt werden, hat das einen dauerhaften Effekt. Auch eine Reform des NetzDG brachte einige Verbesserungen – grundlegende Probleme und Regelungslücken bleiben aber bestehen.
Hate Speech im Internet stoppen: Was getan werden muss
Der Rechtsstaat muss auch im Internet seiner Verantwortung nachkommen und bestehende Gesetze konsequent umsetzen. Beleidigungen, die wir uns in der Öffentlichkeit niemals gefallen lassen würden, werden im Netz toleriert. Erst durch Anzeigen werden die Kommentare juristisch überprüft, der Rechtsstaat übernimmt die Verantwortung und private Betreiber*innen sind nicht mehr in der Rolle von Richter*innen. Die Justizminister*innen der Länder müssen sich dieser Verantwortung jetzt stellen.
Wie Trolle eine demokratische Debatte unmöglich machen Forschungsbericht zu extremistischen Aktivitäten im Netz
Kampagnenpartner